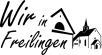"Starke Frauen" - So der Titel der kleinen Serie auf WiF, die sich mit außergewöhnlichen Frauen beschäftigt, die ohne großes Aufsehen in unserer dörflichen Mitte leben, obschon sie Tag für Tag besondere Herausforderungen stemmen und große Stärke beweisen. Im vierten und letzten Teil werfen wir einen Blick auf Marianna Bornemann. Sie ist Intensivkrankenschwester und hat in den letzten beiden Jahren auf der eigens eingerichteten Corona-Intensivstation im Krankenhaus Gerolstein gearbeitet. Was sie besonders während der Anfangsphase der Pandemie alles auf ihrer Arbeit erlebt und mitgemacht hat, wie die Situation sie auch persönlich betroffen hat und was sie nach all den Erfahrungen heute über ihren Beruf denkt, hat sie uns in einem sehr aufschlussreichen Gespräch verraten. Sehr lesenswert!
Begonnen haben wir unsere Reihe über "Starke Frauen" in Freilingen mit einem Interview mit Esther Schwarz (geborene Bornemann), die mit 39 Jahren als alleinerziehende Mutter vor kurzem ein Unternehmen in einer männerdominierten Branche übernommen hat. Ihr Selbstbewusstsein, die innere Stärke und vor allen Dingen ihre Überzeugung, dass man auch als Frau alles schaffen kann, wenn man nur will, hat sie offenbar gererbt, in jedem Fall aber anerzogen bekommen, und zwar von ihrer Mutter.

Da ist es mehr als naheliegend, dass wir uns im 4. und letzten Teil der Serie einmal mit der anderen starken Frau im Hause Bornemann beschäftigen, mit Marianna, die als Intensivkrankenschwester auf der Covid-Station im Krankenhaus in Gerolstein arbeitet.
Die 61jährige stammt nicht gebürtig von Freilingen, sondern wurde in Lünen im westlichen Westfalen geboren. „Echte Westfalen” gelten als zuverlässig, ehrlich, treu, fleißig, aber auch eher zurückhaltend.
Ob das auch auf die zierliche Marianne zutrifft, will ich im Interview mit ihr erfahren, das ich bei uns zu Hause führe.
Als erste Frage drängt sich natürlich auf, wie sie reagiert hat, als ihre Tochter mit der Idee kam, ein Unternehmen zu übernehmen.
"Sofort toll, habe ich gedacht, so habe es ihr ja auch vorgemacht. Das war immer auch meine Erziehung: Mädchen können alles. Das versuche ich auch meinen Enkeltöchtern beizubringen", antwortet sie spontan, ohne lange zu überlegen.
Das sei ihr immer das Wichtigste gewesen, sie zu einer starken Frau zu erziehen. Dass sich manche Mädchen, vor allen Dingen in den sozialen Medien, selbst auf Äußerlichkeiten reduzieren würden, findet sie ganz schlimm.
"Gegenseitige Wertschätzungen für das, was man ist und macht, ist wichtig und nicht, wie jemand aussieht, vielleicht sogar nur mit Hilfe von Botox oder ähnlichem. Man muss auch keine äußeren Fassaden aufrecht erhalten, wenn es einem schlecht geht. Gutes Aussehen ist unbestritten ein Geschenk, aber der Mensch dahinter ist wertvoller. Deshalb ist es so wichtig, hinter die Fassade zu gucken und festzustellen, dass jemand vielleicht doch nett ist, auch wenn er oder sie bescheuert aussieht", führt sie als Erklärung noch an.
"Ich gehörte schon relativ früh zu den Frauen, die auch mit Kindern immer berufstätig sein wollten und waren. Ich wollte immer selbstständig und eigenverantwortlich und damit ein Stück weit unabhängig sein. Das war mir immer sehr wichtig. Mein Vater hatte mir damals gesagt: du bist ein Mädchen, du wirst ohnehin irgendwann heiraten und Kinder bekommen. Ich aber wollte damals unbedingt Abitur machen und hatte sogar die guten Noten dafür. Aber ich kam nicht von der Hauptschule weg, weil mein Vater meinte, er könnte sich das nicht leisten, dass ich auch noch auf das Gymnasium ginge, weil mein älterer Bruder dort schon war und auch noch zwei jüngere Geschwister in der Reihe standen", erzählt sie von der Situation zu Beginn ihrer schulischen Ausbildung
Nach der Hauptschule besucht sie zwei Jahr lang die Berufsfachschule für Ökotrophologie und erlangt die mittlere Reife und damit die Qualifikation für eine Ausbildung als Krankenschwester. Im Hinterkopf hat sie dabei aber immer, auf der Fachoberschule das Abitur nachzuholen, um etwas in Richtung Sozialarbeit zu studieren. Sie ist davon überzeugt, dass man auch als Mädchen alles machen kann, was man nur will.
1975 besucht sie mit einer Freundin deren Verwandte in Altenburg in der ehemaligen DDR. Dort sieht sie, dass Frauen kein Berufszweig verwehrt ist. "Ich habe junge Frauen kennen gelernt, die studieren wollten, viele von ihnen Ingenieurwesen. In der DDR war es völlig normal, dass Frauen als Ingenieurinnen arbeiteten, auch mit Kindern. Die Frauen wurden auch nicht als Rabenmutter verschrien, wenn sie schon kurz nach der Geburt wieder arbeiten gehen wollten, was unproblematisch möglich war, weil die Kinderbetreuung dort schon damals ganz anders geregelt war. Das gab es hier im Westen in der Selbstverständlichkeit gar nicht", beschreibt sie die Erlebnisse.
Finanzielle Unterstützung aus dem Elternhaus kann sie allerdings bei ihren Plänen nicht erwarten. In jedem Fall will sie aber nach der Schule einen eigenständigen Weg gehen, so dass sie für die Ausbildung zur Krankenschwester 1977 ins 180 km entfernte Köln in ein Schwesternwohnheim zieht. Nach der dreijährigen Ausbildung im Krankenhaus plant sie, in einem Krankenhaus in Wesseling zu arbeiten.
Während der Ausbildung lernt sie ihren Mann Guido aus Hüngersdorf kennen. Eine Freundin aus der Krankenpflegeschule kommt aus dem ihr unbekannten Eifeldorf und erzählt und schwärmt fortwährend von der schönen Eifel. Sie wird neugierig und folgt schließlich einer Einladung ihrer Freundin nach Hüngersdorf, wo sie in der Mainacht 1978 auf den großen blonden Eifeler trifft, der sie direkt fasziniert. Im August funkt es dann richtig zwischen den beiden.
1980 wird geheiratet. Ihre Pläne mit die Arbeit im Krankenhaus Wesseling zerschlagen sich, weil sie schwanger wird. Die jungen Eheleute ziehen nach Heimerzheim, wo 1981 ihr Sohn auf die Welt kommt.
16 Monate später folgt Kind 2. In der Folge ist nicht daran zu denken, wieder im Beruf zu arbeiten, da sie keinen Platz für ihre Kinder im Kindergarten bekommt. 1987 bietet sich für die Familie ein Umzug in die Eifel an, da Guido als staatlich geprüfter Landwirt die Gelegenheit erhält, die Leitung des landwirtschaftlichen Betriebes auf Vellerhof zu übernehmen. In der Eifel klappt es dann auch mit dem Kindergartenplatz für ihre fast 5jährige Tochter (ihr Sohn geht inzwischen auf die Grundschule), so dass sie endlich wieder in ihren geliebten Beruf einsteigen kann.
Allerdings sind die Betreuungszeiten in Kindergarten und Schule damals noch recht begrenzt, so dass nur eine Arbeit bei der Caritas in der häuslichen Krankenpflege in Betracht kommt, da dort die Arbeitszeiten (am Anfang hauptsächlich Wochenenddienste) am flexibelsten gewählt werden können. Teilzeitarbeiten im Krankenhaus ist damals noch unüblich und eine Kinderbetreuung schwierig zu finden.
Später übernimmt sie Nachdienste im Altenheim auf Vellerhof, weil dort dringend Personal gesucht wird. Das ist eine anstrengende Zeit: eine Woche Nachdienst, eine Woche frei. Als sich die Chance ergibt, auf Vellerhof einen Hofladen zu eröffnen, in dem auch Bewohner von Vellerhof integriert werden sollen, übernimmt sie die Leitung und Organisation des Ladens und die Betreuung der Mitarbeiter.
1999 zieht die Familie nach Freilingen, da Guido die Arbeitsstelle wechselt.
"Eigentlich wollten wir nur für ein Jahr nach Freiligen ziehen und uns dann in Hüngersdorf etwas suchen. Aber dort war nichts frei", fügt sie lachend an. Heute sei sie total glücklich in Freilingen und wollte auch nicht mehr weg von hier.
Mit dem Wohnungswechsel folgt dann auch die lang ersehnte berufliche Veränderung. Das Krankenhaus Adenau sucht zu der Zeit Krankenschwestern. Sie bewirbt sich und bekommt die Stelle. Zunächst beginnt sie auf der Chirurgie, wechselt aber schon einige Zeit später in den Schichtdienst auf die Intensivstation.
"Ja, endlich habe ich gedacht. Das war schon immer mein Traum, da dort die interessanteren Fälle liegen. Die besondere Herausforderung hat mich schon immer fasziniert, auch wenn man dort natürlich noch mehr Verantwortung trägt", beschreibt sie ihre Freude damals.
Schon zu dieser Zeit ist eine unheimliche Fluktuation auf der Station zu verzeichnen, weil die jüngeren Kolleginnen schwanger werden oder aus privaten Gründen wechseln. Irgendwann wird das kleine Krankenhaus in Adenau umstrukturiert. Auch die Intensivstation wird geschlossen, auch weil sie personaltechnisch nicht zu besetzten ist. Stattdessen wird eine sog. IMC aufgemacht, eine Intermediate Care Station, eine Art Intensivstation light mit geringerer Ausstattung und weniger Personalbedarf für Patienten mit einem höheren Überwachungsstufe als auf der Normalstation.
"Ich habe dann zunächst auf der IMC gearbeitet, aber schnell festgestellt, dass das nicht meins ist, da man auch rundherum noch andere Patienten auf den Normalstationen versorgen musste, was eine unheimliche Lauferei bedeutete. So wollte ich nicht arbeiten", beschreibt sie die damaligen Arbeitsbedingungen.
2019 wechselt sie auf die Intensivstation nach Gerolstein. Hier trifft sie auf ein tolles Team und ist begeistert vom Arbeitsumfeld.
Dann, Anfang 2020 verändert Corona den Krankenhausalltag schlagartig. Der Hygieneaufwand ist gewaltig. Zu Beginn der Schicht heißt es Umziehen, durch eine Schleuse gehen, Kopfbedeckung, Maske und Brille (bei ihr zusätzlich über die Gleitsichtbrille) anziehen. Dann noch den ersten Schutzkittel überziehen und die Schuhe wechseln. Erst danach geht es auf die Station.

(Bespiel für das komplette Schutzkleidungsprogramm)
"Wenn Du auf der Station warst, konntest du anschließend nichts mehr essen und trinken, weil die ganze Station eine reine Covid-Station war und die Gefahr zu groß war, sich zu infizieren. Wir haben dann irgendwann kalorienreiche Drinks über einen Strohhalm bei offenem Fenster ganz schnell getrunken. Ansonsten musste man sich komplett umziehen, wenn man eine Pause machen wollte. Ein unheimlicher Aufwand. Pausen konnten ohnehin nur gemacht werden, wenn ein Arzt kam, da wir relativ zügig eine hohe Belegung hatten und immer etwas zu tun war", schildert sie die Anfänge der Pandemie.
Nach und nach werden die Schutzmasken knapp. Sie werden dann mit Namen versehen und zum Trocknen aufgehängt, um sich wenigstens irgendwie schützen zu können.
Täglich fast 8 Stunden ohne richtiges Essen und Trinken, das zerrt an der Substanz. Die Arbeitsbelastung steigt und damit auch das Gefühl, dass man immer nur hinterherhechtet und die Patienten nicht optimal versorgt bekommt. Der Zustand vieler Patienten belastet die psychische Situation.
"Da ging es ja nicht einfach mal um eine Beatmung. Viele bluteten in die Haut rein oder aus Mund und Nase heraus. Immer wenn man dachte, jetzt ist der Patient stabil, hat sich die Situation nur 10 Minuten später verschlechtert: Maximale Instabilität, Absaugen, Sedierung hochfahren, immer weiter das komplette intensivmedizinische Programm ", erzählt sie von ihren Erlebnissen
Die Intensivstation ist wochenlang mit 6 Patienten maximal belegt. Sie ist alleine für drei Patienten zuständig, weil auch aus politischen und letztlich Kostengründen während der Coronapandemie auch noch die Betreuungsrate verändert wird, von 1 : 2 auf 1 : 3.
Pflegepersonal ist knapp und teuer, erst recht in Corona-Zeiten.
"Ich bin nach Hause gefahren und war eigentlich froh über den relativ langen Nachhauseweg, weil ich dann schon einmal eine Runde knatschen konnte, vor lauter Erschöpfung. Man ist dann einfach nur noch erledigt. Bevor ich dann etwas essen konnte, hieß es zu Hause erst einmal Duschen, nachdem ich mich im Flur ausgezogen und alles in die Waschmaschine gesteckt hatte. Man zieht ja ohnehin nur die ältesten Klamotten zum Dienst an, weil man Angst hat, dass alles kontaminiert ist und daher jeden Tag die Sachen waschen muss", beschreibt sie die Situation in ihrem Alltag.
"Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viel geduscht, Hände und Wäsche gewaschen, wie zu dieser Zeit, weil ich auch andauernd meine Bettwäsche und Handtücher gewechselt habe. Ich habe mir dabei auch meine Lieblingsjeans regelrecht kaputt gewaschen. Das hat natürlich auch eine unglaubliche Wasserrechnung für uns ergeben, so wie für alle anderen auch. Am meisten ärgert es mich im Nachhinein, dass es eine steuerfreie Kostenpauschale für die Abgeordneten des Bundestages gibt, mit denen Kosten für die Ausübung des Mandates abgedeckt werden. Die ist im Januar auf über 4.500 € angehoben worden. Das hat mich total geärgert und ich habe mich nur gefragt, warum die das bekommen und ich nicht", führt sie schon fast aufgebracht an.
"Und wir kämpfen darum, dass wir vielleicht dieses Jahr noch einmal 500 € bekommen als Vollzeitkraft", ergänzt sie sichtbar verärgert. Ungerechtigkeiten ärgern sie gewaltig und diesem Unmut macht sie auch Luft.
Zu dem Zeitpunkt unseres Gesprächs weiß sie noch nicht, dass die Bundesregierung inzwischen die Auszahlung des Pflegebonus 2022 beschlossen hat und Fachpflegekräfte im Intensivbereich nach vorläufigen Berechnungen ab dem Sommer mindestens 2.500 Euro erhalten sollen. Wenigstens mal eine hinreichende finanzielle Anerkennung.
Aber Geld ist die eine Seite, die körperliche und seelische Situation eine andere.
Denn in dieser Zeit machen sich nicht zuletzt auch wegen der psychischen Belastung körperliche Beschwerden bemerkbar.
"Meine Schuppenflechte ist damals regelrecht explodiert, nicht zuletzt wegen des ganzen Desinfektionsmittels, das ja auch in der Beschichtung der Schutzkittel enthalten ist. Ich hatte anfangs Ausschlag an den Beinen und überall einen Juckreiz. Jetzt hat meine Haut sich wohl daran gewöhnt", erzählt sie ruhig.
"Dann konnte ich einen Zeit lang die Masken nicht vertragen, so dass ich starkes Nasenbluten bekam, weil die Schleimhäute angegriffen waren. Meine Nase ist bis heute drangsaliert. Selber zum Arzt gehen wollte ich damals nicht, weil ich ja Covid-Patienten betreute und meine größte Sorge war, dass ich irgendwie zum Superspreader werde und in der Bild-Zeitung die Schlagzeile zu lesen ist: Krankenschwester hat 37 Menschen angesteckt. Ich wollte auf keinen Fall, andere gefährden. Man entwickelt da schon eine gewisse Paranoia", beschreibt sie ihre permanente Angst.
Der Körper habe in dieser Zeit schon gelitten. Abgenommen habe sie trotz der schwierigen Arbeits- und Pausenbedingungen allerdings nicht.
"Ich habe mir in der Zeit angewöhnt, immer etwas zu Essen mit ins Auto zu nehmen, für den ganz großen Hunger auf den Hin- und Rückfahrten", erzählt sie weiter. Gewicht habe sie auch deshalb keines verloren, weil man sich mit Müsliriegel und Energie-Drinks über Wasser gehalten habe. Sie habe auch damals direkt angefangen, Vitamin B Komplexe und Magnesium einzunehmen, "damit die Psyche und das Herz halten".
Das hat sie sich letztlich selbst verordnet. Von Seiten des Krankenhauses ist ein besonderer psychologischer Beistand im medizinischen Sinne nicht geleistet worden.
"Was toll war, war die Presse für uns und die Öffentlichkeit. Viele Unternehmen in Gerolstein haben für uns gespendet und wir bekamen von überall her Gutscheine geschenkt. Einmal stand die Pflegedienstleiterin mit zahlreichen Pizzen auf der Station. Die konnten wir ja gar nicht essen", beschreibt sie die Reaktionen in der Öffentlichkeit.
Die erste Hochphase geht bis in den Sommer, bis es sich ein wenig beruhigt. Dann bekommt das Krankenhaus eine Lieferung minderwertiger Masken.
Augenscheinlich sind sie nicht fehlerhaft, so dass niemand erkennt, dass sie unzureichend geprägt sind und damit letztlich eine Gefahr bedeuten. Prompt werden Mitarbeiter krank, sowohl Ärzte als auch Krankenschwestern. Sie selbst infiziert sich nicht. Aber der Personalausfall muss zusätzlich kompensiert werden. Irgendwann ist es dienstplanmäßig fast nicht mehr zu leisten, Man hält sich dann mit Bereitschaftsdiensten über Wasser.
Im Herbst 2020 rückt die zweite Welle an, die aber nicht mehr ganz so dramatisch ausfällt. Auch ist inzwischen der Personalschlüssel wieder geändert worden, da nach der ersten Hochphase der Pandemie eine "Kündigungswelle" eingesetzt hat, aus verschiedensten Gründen, natürlich auch wegen der persönlichen Erfahrungen und des unbeschreiblichen Patientenleids und Krankheitsverlaufs bis hin zum Tod.
"Bei vielen konnte man aufgrund des schlechten Zustands der Lungen direkt absehen, wie sich das entwickelt. Auch die Gefäßveränderungen bis hin zu dunkelblauen Beinen bei zahlreichen Patienten ließ meistens nichts Gutes erahnen. Sie entwickelten hohes Fieber und man konnte dabei zusehen, wie sie in die Haut eingeblutet haben. Einfach so. Man musste sie behandeln wie rohe Eier. Wir waren über jeden froh, der das überlebt hat", beschreibt sie anschaulich die Situation.
"Das Allerschlimmste für mich in dieser Zeit war zum einen, dass Menschen ohne Angehörige alleine sterben mussten und zum anderen die Erkrankung einer Kolleigin im Sommer 2020, die bis heute krank ist", fügt sie noch an.
Viele Patienten, die die Intensivstation lebend verlassen, zeigen anschließend große Dankbarkeit. Die Station bekommt Dankesbriefe und Fotos aus den Rehas. Angehörige rufen an und sprechen ihren Dank aus. Diesmal eine Welle der erfreulichen Art. Auch die Aktion mit dem Beklatschen des Personals tut gut.
"Das war wie Streicheleinheiten für die Seele", schmunzelt sie. Genau dafür liebt sie ihren Beruf: für das Gefühl, anderen geholfen zu haben, aber dafür auch eine Wertschätzung zu bekommen. "Es tut einfach gut, wenn einer sagt, dass man richtig nett gewesen sei. Dann antworte ich immer: ja, ich kann auch richtig nett", führt sie noch an, in der wohl typisch zurückhaltenden Westfalenart.
Auch das gegenseitige Aufmuntern und Motivieren unter den Kolleginnen, im Team und den WhatsAppGruppen habe gut getan.
Natürlich hofft man in dieser Situation, dass sich auch irgendetwas an der miserablen Situation ihres Berufstandes ändert, auch, was die schlechte Bezahlung angeht, vor allen Dingen für die Wochenenddienste und Nachtschichten. Aber es ändert sich erst einmal nichts.
Allerdings nimmt wenigstens die Zahl der Covid-Patienten nach und nach ab. Inzwischen liegen auf der Intensivstation auch wieder "normale" Patienten. Für die Covid-Patienten gibt es noch ein Schleusenzimmer, das zwischendurch immer mal wieder besetzt ist und wofür dann schon routinemäßige das komplette Hygieneprogramm abgespielt werden muss. Aber wenigstens gibt es keine Materialknappheit mehr. Die Situation ist heute schon fast entspannt
Ob sie selbst zu irgendeinem Zeitpunkt überlegt habe, zu kündigen, weil sie der Belastung nicht mehr gewachsen sei?
"Nein, nie, das ist aber meinem hohen Alter geschuldet", antwortet sie leicht schmunzelnd und meint damit wohl eher ihr gereiftes Verantwortungsbewusstsein als ihren körperlichen Zustand, denn trotz ihrer eher zarten Gestalt scheint sie physisch wie psychisch ausgesprochen belastbar.
"Vielleicht habe ich eine besonders hohe Resilienz, ich weiß es nicht. Wir sprechen uns auf der Station ja bei den Arbeiten auch ab. Für mich ist das überhaupt keine Frage, dass ich die Covid-Patienten übernehme, wenn die Kollegin da nicht unbedingt Lust drauf hat. Ich hatte bis jetzt ein tolles Leben. Ich bin Gott sei Dank nie an Covid-19 erkrankt", erzählt sie. Das liegt vielleicht auch daran, dass sie sich in ihrer Freizeit mit Joggen fit hält.

(Marianna im Dienst)
"Ich bin oft genug nach Hause gekommen, habe eine Banane gegessen und bin sofort laufen gegangen. Diese körperliche Anstrengung ist für mich wie Meditation oder Yoga, das macht was mit einem. Auch Kochen ist was tolles, Gemüseschneiden entspannt regelrecht", führt sie schmunzelnd an. Allerdings hätte es zu Hause während der Hochphase von Corona relativ oft Nudeln gegeben, weil sie Angst gehabt habe, sich beim Kartoffelschälen in die Finger zu schneiden und damit die Infektionsgefahr zu erhöhen.
"Die größte Angst war, dass ich irgendetwas mit nach Hause schleppe", ergänzt sie und beschreibt, wie schwer es ihr gefallen sei, sich aus dieser Angst heraus auch von der Familie stark zu separieren. Guido und die Kinder hätten sie zu jeder Zeit unterstützt und ermutigt. Nachdem der Impfstoff zur Verfügung gestanden habe, habe sich die mentale Situation und damit auch diese Sorge dann gebessert.
Dass sich bis heute Menschen gegen eine Impfung entscheiden, kann sie absolut nicht nachvollziehen, erst recht nicht bei Mitarbeitern im medizinischen Bereich. "Vor allem Männer in meinem Alter haben offenbar ein Problem mit der Impfung, weil die Angst besteht, man würde dadurch impotent. Solche Diskussionen habe ich öfter im Krankenhaus geführt. Männer und ihre Potenz, gerade um die 60...da sind manche wirklich total bescheuert", fährt es aus ihr raus.
Auch kann sie nicht nachvollziehen, dass die Maskenpflicht abgeschafft worden ist. "Wir haben immer noch Covid, auch wenn andere Themen wie die Hochwasserkatastrophe und jetzt der Krieg in der Ukraine das Thema in den Schatten gestellt haben. Bei mir ist die Vorsicht immer noch hoch, auch im Hinblick auf die hohen Infektionszahlen. Ich habe in jeder Jacke eine Maske und ziehe die auch noch überall in Innenräumen an".
Eine starke Frau mit klaren Prinzipien.
Diese Einstellung vermittelt sie auch ihren Enkeltöchtern. "Sie fragen oft, was ich im Krankenhaus erlebe. Das erzähle ich ihnen dann auch, aber vor allem auch die guten Dinge, dass z.B. die Leute auch danke sagen oder froh sind, dass ihnen geholfen wird". Die älteste Enkelin habe sogar schon überlegt, auch Krankenschwester zu werden. Aber die Oma macht ja auch regelrecht Werbung für ihre Arbeit, trotz allem.
"Ich finde den Beruf immer noch toll. Ich würde auf keinen Fall etwas anderes machen wollen. Es ist nur schade, dass dies heute nicht mehr so richtig vermittelt wird bzw. werden kann, obwohl wir die jungen Leute brauchen. Das Leben findet ja nicht nur von montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr statt, sondern 365 Tage lang, 24 Stunden am Tag. Nachwuchs für diesen Beruf ist wichtig. Da muss dringend etwas getan werden. Man kann nicht einfach irgendwelche Personaluntergrenzen festsetzen, weil es angeblich anders nicht geht. Man muss anders mit den Menschen im Gesundheitswesen umgehen: mehr Personal, bessere Bezahlung vor allen Dingen an Sonn- und Feiertagen. Es kann doch einfach nicht sein, dass man z.B. im Bankwesen ganz gut verdient, obwohl man in dem Bereich in der Regel weder am Wochenende noch an Feiertagen arbeiten muss. Da muss es endlich bundesweit einheitlich einen Tarif geben", fordert sie nachdrücklich.
Dennoch ist das immer noch ihr Traumjob.
"Ich bin seit 42 Jahren Krankenschwester.", erklärt sie nicht ohne Stolz. Dennoch kann sie es nicht nachvollziehen, dass man in der Berufsfeuerwehr wegen des Schichtdiensts schon mit 60 Jahren in Rente gehen kann, sie als Krankenschwester aber bis 66 Jahren arbeiten müsse. Diese Ungleichbehandlung findet sie einfach ungerecht. Daher will sie versuchen, ihre Rente früher durchzubekommen, damit einfach mehr Zeit für sich, die Familie und vor allen Dingen ihren Mann bleibt, der vor einiger Zeit in Rente gegangen ist. Ideen für die gemeinsame Zeit hätte die sportliche und reiselustige, campingbegeisterte Frau in jedem Fall genug.
Verdient hätte sie es darüber hinaus nach den Erlebnissen und Kraftanstrengungen gerade in den letzten zwei Jahren in jedem Fall. Drücken wir ihr die Daumen, dass es mit ihren Plänen klappt, auch wenn sie am Ende des Gesprächs auf die Frage nach ihren Wünschen feststellt: "Ich bin glücklich, wunschlos glücklich und total zufrieden".
Und dank dieser Begeisterung für ihren Beruf würde sie wohl in jedem Fall auch bis zum Schluss als Krankenschwester arbeiten gehen, selbst wenn es denn mit dem früheren Renteneintritt nicht klappen sollte.
Bewundernswert!
Zum Schluss gehen auch an sie die traditionellen letzten vier Fragen.
Lieblingsessen: "Tja, was lieb ich denn?...Steaks, medium!"
Lieblingsmusik: "Phil Collins und Genesis, Herbert Grönemeyer und natürlich die Toten Hosen, wo ich schön laut mitsingen kann"
Lieblingsurlaubsland: "Deutschland"
Lieblingssport: "Kanufahren. Das habe ich während der Pandemie total vermisst. Auf dem Fluss und dann dieses gleichmäßige Paddeln...das ist Ganzkörper-Yoga"
Wir bedanken uns bei Marianna (die von vielen und sogar oft genug vom eigenen Mann übrigens fälschlicherweise Marianne genannt wird) ganz herzlich für dieses aufschlussreiche Gespräch und vor allen Dingen für ihren unermüdlichen, selbstlosen Einsatz in den letzten Jahren an der "Corona-Front", an der sie nicht wenigen Menschen das Leben gerettet hat.
Marianna, danke !!!!
Damit endet unsere kleine Serie. An dieser Stelle möchte ich aber noch auf eine ganz besonders starke Frau hinweisen, mit der wir bereits vor einigen Jahren kurz vor ihrem 100. Geburtstag ein langes, sehr beeindruckendes und berührendes Gespräch geführt haben.
Sie ist inzwischen leider verstorben, aber ihr Schicksal und ihre Erlebnisse passen in jedem Fall ganz wunderbar in diese Reihe. Die Rede ist von Helene Roznowicz, deren Interview unter folgendem Link nachgelesen werden kann: Im Gespräch mit...Helene Roznowicz

Wer den Bericht damals nicht gelesen hat, sollte dies unbedingt nachholen!!!