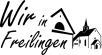"Dorfgeschichte" - am kommenden Wochenende, 22. und 23. April, wird im Bürgerhaus in Freilingen zur Abwechslung einmal nicht gefeiert, sondern auf ein Stück Geschichte zurückgeblickt. In einer zweitägigen Ausstellung geht es um das Thema Zwangsarbeit im Kreis Euskirchen während der NS-Gewaltherrschaft im zweiten Weltkrieg. Besonders beleuchtet wird dabei das Schicksal des Polen Marian Moroz, der in Freilingen Zwangsarbeit leisten musste und sich dabei verbotener Weise in eine junge Frau aus dem Ort verliebte. Seine 42jährige Enkelin Mira Moroz, die in Polen geboren wurde und als Kind mit ihren Eltern nach Freilingen zog, wird am Sonntag auf eindringliche Art berichten, was ihr Großvater alles erlebt hat. WiF sprach im Vorfeld mit ihr über ihre Familiengeschichte, ihre persönlichen Erlebnisse und Erfahrungen als polnische Spätaussiedlerin, den Umgang mit dem Thema Zwangsarbeit und wie man heute in Polen auf Deutschland blickt. Ein sehr interessantes Interview!

Mira Moroz wurde vor 42 Jahren in Polen geboren und zog Ende der 80er Jahre mit ihren Eltern nach Freilingen, den Geburtsort ihrer deutschen Großmutter Katharina, aber auch den Ort, an dem ihr polnischer Großvater Marian unter der NS-Herrschaft im zweiten Weltkrieg Zwangsarbeit leisten musste.
Unter dem Titel "Ohne Krieg wäre ich nicht" hat sie im Rahmen der Ausstellung "Zwangsarbeit im Kreis Euskirchen" in Vogelsang bereits im November letzten Jahres mit Hilfe eines animierten Kurzfilms vom Schicksal ihres Opas und dessen verbotener Liebesbeziehung erzählt.
Am kommenden Sonntag berichtet sie im Rahmen der Ausstellung zum Thema "Zwangsarbeit im Kreis Euskirchen" am 22. und 23. April auch im Bürgerhaus in Freilingen um 15.00 Uhr von dem Schicksal ihres Großvaters. Im Vorfeld haben wir mit ihr über ihre Familiengeschichte, die Aufarbeitung für die Ausstellung, aber auch über ihre persönlichen Erfahrungen als polnische Zuwanderin und allgemein über das Verhältnis Deutschland/Polen gesprochen.

WiF.: Mira, erzähl uns bitte ein wenig über Dich!
Mira: Ich habe seit den 2000er Jahren mit kurzen Unterbrechungen in Köln gelebt und bin seit 15 Jahren Teil einer wunderbaren Hausgemeinschaft in Nippes. Vor meinem Studium des Kommunikationsdesign an der ecosign habe ich als Mediengestalterin in Köln und Düsseldorf gearbeitet. Während meines Studiums habe ich mich intensiv mit den Themen der Nachhaltigkeit auseinandergesetzt, was mich bis heute stark beeinflusst: Wie kommuniziert man Nachhaltigkeit/eine nachhaltige Lebensweise ohne mit der moralischen Keule zu schwingen.
Ehrlicherweise habe ich aber in meiner Arbeit als freie Mitarbeiterin für verschiedene Agenturen aus wirtschaftlichen Gründen viel Greenwashing betrieben. Daher versuche ich seit einigen Jahren überwiegend für Kunden aus dem kulturellen und sozialen Bereich wie die Caritas, die deutsche Denkmalstiftung und diverse Bildungseinrichtungen im Kölner Gebiet zu arbeiten. Zusätzlich dokumentiere ich Veranstaltungen jeglicher Art, aber das nur gelegentlich, denn jedes Wochenende ein Event, das wäre zu viel, das ist ein Knochenjob.
Neben meiner gestalterischen Tätigkeit habe ich auch ein zweites Standbein in der Pflegetherapie, wo ich Pfleger*Innen in Marte Meo schule. Diese Arbeit erfüllt mich ebenso und bietet einen guten Ausgleich zu meiner kreativen Arbeit.
WiF: Was weißt Du von Deinem Opa, Marian Moroz?
Mira: Ich musste die Geschichte meines Opas auch erst aufarbeiten, da er Anfang der 90er verstorben war und ich als 9-jährige nicht derartige Fragen gestellt habe wie „Opa erzähl doch mal wie war es im Krieg“. Basierend auf einem Interview mit einer polnischen Geschichtsstudentin und den Erzählungen seiner Kinder, kann ich die Ereignisse wie folgt wiedergeben: nur wenige Wochen nach der deutschen Invasion in Polen 1939 wurde eine polnische Artillerieabteilung in der Nähe von Tschenstochau zerschlagen.
Unter den polnischen Kriegsgefangenen befand sich damals auch mein Opa, Marian Moroz, der damals 26 Jahre alt war und als Unteroffizier und Bombardier für die polnische Armee kämpfte. Marian entstammte einer gutbürgerlichen Familie, die ihm die Möglichkeit bot, sich im Bereich der Musik und Kunst auszubilden, weshalb er auch als Auftragsmaler tätig war.
Als Kind seiner Zeit hatte mein Opa einige antisemitische Stereotype verinnerlicht, wie seine späteren Aussagen über „geizige“ jüdische Händler in Tschenstochau zeigten. Der Antisemitismus war zu der Zeit in Europa weit verbreitet und auch in Polen salonfähig. Mit dem Ausbruch des Krieges änderte sich Marians Leben aber dramatisch als er in Kriegsgefangenschaft fortan in einem österreichischen Steinbruch unter schwierigsten Bedingungen mit einem Schlageisen arbeiten musste.
Die Arbeit war kräftezehrend und diente dem deutschen Regime als Kriegsbeute zur Deckung des wachsenden Bedarfs an Baumaterialien für Hitlers Bauvorhaben. Marian versuchte dieser Situation zu entkommen und hatte schließlich das Glück, in den ländlichen Gebieten Westdeutschlands gebraucht zu werden. So kam er mit zwei weiteren polnischen Kriegsgefangenen nach Freilingen, wo er meine Oma kennenlernte und sich verliebte.
WiF: Wann hast Du zum ersten Mal von dem Schicksal Deines Großvaters erfahren?
Mira: Ich glaube unbewusst wuchs ich mit der Tatsache auf, dass mein Opa in einem Krieg involviert war, über den in Polen in den 80er Jahren viel gesprochen wurde. Es kamen auch ständig schwarz-weiß Filme zu dem Thema im Fernsehen. Aus meiner kindlichen Perspektive war es ein furchtbarer Krieg, der von einem schrill schreienden Deutschen namens Hitler angezettelt wurde und mein Opa kämpfte auf jeden Fall auf der Seite der Guten gegen die Nazis. Erst später erfuhr ich, dass er in Kriegsgefangenschaft geraten war.
Für mich war Zwangsarbeit etwas Normales, etwas, das im Krieg passierte (Arbeit als Kriegsbeute). Immerhin hatte mein Opa nicht an der Front kämpfen müssen und war auch nicht im Konzentrationslager. Das bedeutete, dass er eigentlich Glück hatte, dass seine Arbeitskraft gebraucht wurde. Ich internalisierte das zunächst so.
Aber das tiefere Verständnis kam erst später als Erwachsene. Ich realisierte, dass polnische Frauen und Männer nach Deutschland verschleppt wurden um als „niedere Menschen“ schwerste körperliche Arbeit in den deutschen Fabriken und auf dem Feld zu verrichten. Diesen rassistischen Aspekt begriff ich erst später. Die polnischen Zwangsarbeiter wurden schlecht entlohnt, stigmatisiert durch Buchstaben-P-Aufnäher hatten sie kaum Rechte und jegliche amourösen Verbindungen zu Deutschen wurde ihnen untersagt mit Androhung der Todesstrafe.
Es war für mich ungeheuerlich, dass mein Opa für so etwas wie Liebe hätte gehängt werden können.
WiF: Wurde in der Familie oft über diese Zeit geredet?
Mira: Nein, nicht wirklich, da meine Eltern Ende der 80er Jahre nach Deutschland auswanderten und wir zu Beginn mehr damit beschäftigt waren als Familie in einem neuen Land anzukommen. Ich musste mit meinen Eltern und meinem Bruder die Sprache lernen, die meine Oma und Hitler gesprochen haben, allerdings klang diese Sprache in Deutschland nicht mehr so schrill, sondern wesentlich freundlicher.
Meine Kindheit und Jugend waren mehr davon geprägt zwischen zwei Ländern zu leben und sich als Deutsche zu begreifen. Die Auseinandersetzung mit dem 2. Weltkrieg beschränkte sich auf die Schule, Bücher, Dokumentationen im Fernsehen und Besuche von Konzentrationslagern. Es kursierten in meiner Familie zwar beiläufig erzählte Geschichten und Erlebnisse aus jener Zeit, aber irgendwie rückte alles in weite Ferne.
Es fiel mir schwer all die Informationen, die ich über die Jahre gesammelt hatte, zu einem konsistenten Bild zusammenzufügen. Es war so als ob diese Geschichte des Krieges nicht wirklich etwas mit mir zu tun hatte. Es war lange vorbei und ich fand es, wie alle jungen Menschen, etwas ermüdend über diese Zeit zu sprechen. Erst in meinen 30ern setzte ein Bedürfnis ein sich stärker mit der eigenen Familiengeschichte im Zusammenhang mit den historischen Ereignissen auseinanderzusetzen.
WiF: Wie hat Dich und Deine Familie diese Geschichte geprägt?
Mira: Ich gehöre noch mit meinen 42-Jahren der Kriegsenkelgeneration an, die aufgewachsen ist in einem familiären Umfeld, wo wie die eigenen Eltern und Großeltern gelernt haben über bestimmte Sachen aus der Vergangenheit nicht zu sprechen, sie zu verdrängen. Ich glaube, Vieles läuft unbewusst ab und erst wenn man sich aktiv damit auseinandersetzt, kommen Themen zum Vorschein. Bei meinem Vater und seinen Geschwistern setzt vielleicht jetzt im Rentenalter eine Art Reflexion ein und der Versuch die Geschichte der eigenen Eltern zurückzuholen oder sich daran erinnern zu wollen.
Ich glaube die stärkste Prägung in unserer Familie, also meinen Eltern, meinem Bruder und mir, zeigt sich darin, dass wir in Freilingen, dem Geburtsort meiner Oma, geblieben sind als wir nach Deutschland auswanderten. Das war für Spätaussiedler nicht unbedingt die erste Anlaufadresse - the place to be - es ergab sich aufgrund der familiären Verbindungen und dem Gefühl verwurzelt zu sein in diesem Ort. Bis heute fühle ich diese Verbundenheit mit Freilingen.
WiF: Hast Du die Familiengeschichte schon einmal in besonderer Form aufgearbeitet?
Mira: Ja, im Rahmen meines Studiums habe ich einen Animationsfilm über das Kennenlernen meiner Großeltern während des Krieges erstellt und zu meiner Abschlussarbeit habe ich meine Großtante, die Schwester meiner Oma, Tant Len, durch ein 10-stündiges Interview geführt und basierend darauf entstand ein Fotoprojekt.
Das Thema arbeitet aber immer noch in mir und ich sehe es noch nicht als abgeschlossen an. Die Geschichte meiner Großtante ist für sich genommen sehr beeindruckend, aber Du hattest Sie ja auch kurz vor Ihrem 100-jährigen Geburtstag interviewt (s. Interview auf WiF mit Helene Roznowicz).
WiF: Die beiden Schwestern aus dem Haus Göbel hatten ähnliche Situationen, aber unterschiedlich gehandelt. Deine Oma Katharina ist nach Polen gegangen, ihre Schwester, Deine Großtante Helene ist mit ihrem polnischen Mann in Deutschland geblieben. Was denkst Du, wer am Schluss mit den meisten Vorbehalten und Ablehnungen zu kämpfen hatte?

(Foto der Familie Göbel, Haus "Komme" von 1926: von links: Katharina Göbel mit den Kindern Lenchen, Kathrinchen und Anton)
Mira: Das ist eine sehr interessante Frage, die ich mir auch oft nur andersrum gestellt habe, welche der beiden Schwestern und ihren Familien erging es besser hinter dem eisernen Vorhang? Aber zurück zu den Vorbehalten, ich glaube, dass es in Deutschland Vorbehalte gegenüber meinen Großonkel Josef Roznowicz gab - besonders von der Seite seines Schwiegervaters, der es nicht akzeptieren konnte, dass seine Tochter einen Polen geheiratet hatte oder sollte ich besser sagen, dass seine beiden einzigen Töchter einen Polen geheiratet hatten. Die Jüngste, meine Oma, war nur zu weit weg um sich beschimpfen zu lassen von meinem Urgroßvater Gerhard.
Das abfällige Wort „Polake“ ist häufiger in familiären Auseinandersetzungen gefallen. Aber auch die Behörden in Deutschland haben sehr rassistisch agiert, indem sie nach der Heirat von Helene und Josef Roznowicz, dem Paar, nein der ganzen Familie die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt haben, auch den nachkommenden Töchtern Rita und Hedwig.
Das Beispiel zeigt, dass trotz der Niederlage im Krieg einige Deutsche eine Überlegenheitshaltung und Feindseligkeit gegenüber Fremden in ihrem geistigen Selbstbild manifestierten. Ich denke diese Einstellung findet bis heute ihren Ausdruck in rechter Gewalt und fremdenfeindlichen Übergriffen, deshalb bleibt es auch in 2023 ein Thema, das uns als Gesellschaft beschäftigt.
Meine Oma wiederrum musste mit Anfeindungen in Polen umgehen lernen. Der Liebe wegen zog sie nach dem Krieg mit der gemeinsamen Tochter Elisabeth nach Tschenstochau, in die Geburtsstadt meines Opas, wo sie auch die Wut der polnischen Bevölkerung zu spüren bekam, weil sie eine Deutsche war. Die polnische Bevölkerung war noch zutiefst verstört von dem deutschen Angriffskrieg und der immensen Zerstörung, die es in Polen hinterließ.
Die Mutter von Marian war daher ebenso wenig erfreut über die deutsche Schwiegertochter wie der Vater Gerhard von seinem polnischen Schwiegersohn Marian, klingt fast nach Shakespeare, wenn ich das so erzähle. Meine Oma wurde von ihrer Schwiegermutter manchmal abfällig als „Niemra“ bezeichnet, ein Wort, das eine alte und hässliche Deutsche beschreibt. Vor diesem Hintergrund finde ich es umso verständlicher, warum wir heute sensibler mit den rassistischen Begriffen für PoC oder Sinti und Roma umgehen.
WiF: Wie war der Austausch/Kontakt der Familien?
Mira: Die beiden Schwestern hatten trotz der Entfernung eine innige Beziehung, die sie per Briefkontakt, Telefonaten regelmäßig pflegten. Sehr selten kam es zu gegenseitigen Besuchen zwischen Tschenstochau und Freilingen, die lassen sich vermutlich in all den Jahrzehnten an einer Hand abzählen. Die politische Situation während des kalten Krieges hat es ihnen erschwert. Nach der Wende wurde es wesentlich leichter für die Familien, einander zu besuchen und den persönlichen Kontakt zu pflegen.
Ich würde sagen, heute ist der Kontakt der Familien sehr herzlich, aber nach dem Tod von Tante Lenchen ist es schwerer, die jüngere Sippschaft an einen Tisch zu bekommen. Das ist nur natürlich, aber auch schade.

(von links: Marian, Katharina, Helene und Josef mit den Kindern Elisabeth und Jürgen nach dem Endes des Krieges 1946 in Freilingen)
WiF: Hast du im Hinblick auf Deine polnischen Wurzeln je negative Erfahrungen gemacht?
Mira: Das Gute an meinem „polnisch“ sein war, dass man es mir nicht ansehen konnte. Ich war blond, blauäugig und habe höchstens meinen Namen erklären müssen „Mira Moroz“, wo kommt der eigentlich her? Das ist nicht wirklich „deutsch“. Noch ein Vorteil war, dass ich akzentfrei Deutsch sprechen konnte, im Gegensatz zu meinen Eltern.
Wann ich diese Sprache meiner Oma gelernt habe? Keine Ahnung, ich wünschte nur, ich könnte heute noch so gefühlt über Nacht eine Sprache lernen. Meine polnischen Wurzeln habe ich zwar nicht verleugnet oder mich dafür geschämt, aber ich bin strategisch damit umgegangen, wem ich das erzählt habe. Im Deutschland der 90er Jahre Pole*In zu sein, das war nicht unbedingt was Gutes. Es gab die Autodiebstähle, die Armut hinter der Oder (das war zumindest die deutsche Perspektive in manchen Fernsehbeiträgen), es gab die Polackensprüche und Harald-Schmidt-Witze über klauende Polen, die ganze Sendungen füllten und es gab rassistische Übergriffe in Rostock, Solingen, gegen Menschen die man Ausländer nannte.
Ich war ja eine sogenannte Spätaussiedlerin mit deutscher Staatsangehörigkeit, das war ein anderer Status. Ich habe es früh verinnerlicht, dass es nicht unerheblich ist, woher man kam und wie man aussah.
Eine Episode fällt mir da ein, meine Englischlehrerin, die ich ansonsten sehr schätze, betonte mehrmals, wie rückständig Polen doch war und sie sich niemals in ein polnisches Flugzeug setzen würde, das sei doch Selbstmord. Diese Aussage damals von ihr war so schräg und drastisch, dass ich mich noch gut daran erinnere.
WiF: Wie wird heute in Polen auf diese Zeit und auch auf Deutschland allgemein geschaut? Gibt es noch spürbare Vorbehalte oder schlechte Stimmung in Bezug auf Deutschland? Wie geht man dort mit dem Thema allgemein um?
Mira: Die Wahrnehmung Deutschlands und die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg sind in Polen nach wie vor sehr präsent. Die meisten Polen haben eine persönliche Verbindung zu der Kriegszeit oder haben Familienmitglieder, die von den Ereignissen betroffen waren. In Polen wurde auch wahnsinnig viel zerstört während des Krieges, beispielsweise die Altstadt von Warschau musste komplett wieder aufgebaut werden, Stein für Stein.
Das Thema des Zweiten Weltkriegs in Polen wird insbesondere bei der älteren Bevölkerung oft mit starken Emotionen und einer persönlichen Bindung behandelt. Für die jüngere Generation, wie die Millennials oder die Generation Z, die inzwischen oft sehr gut Englisch sprechen und durch das Aufheben der Reisebeschränkungen seit 2004 jede Ecke Europas erkundet haben, scheint das Thema und die Vorbehalte gegenüber Deutschland jedoch in weite Ferne gerückt zu sein.
Polen und Deutsche haben oft ein sehr positives Bild voneinander und pflegen freundschaftliche Beziehungen, das ist mein Eindruck in den letzten Jahren. Allerdings gibt es auch Sorgen bezüglich der derzeitigen rechtskonservativen Regierung in Polen, der Pis-Partei, die antideutsche Ressentiments schürt und bewusst Propaganda betreibt, indem sie eine schlechte Stimmung gegenüber Deutschland und Europa verbreitet. Ich hoffe nur, dass diese Regierung nicht wiedergewählt wird.
WiF: Wie ist es dazu gekommen, dass Du bei der Ausstellung mitgearbeitet hast?
Mira: Vor einigen Jahren hatte ich ein Interview mit Franz Albert Heinen für eine Buchpublikation über die Zwangsarbeit in der Eifel geführt („Abgang durch Tod“). Ich erinnere mich nicht mehr daran, wie dieser Kontakt damals zustande kam, da es bereits neun Jahre her ist. Jedenfalls hat Herr Heinen eine besondere Begabung dafür, unnachgiebig in allen Unterlagen zu forschen und seine Fühler überall auszustrecken. Er muss meine Familie/mich gefunden haben, nicht ich ihn, das ist schon mal sicher. Im Zusammenhang mit der Zwangsarbeiter-Ausstellung in Vogelsang wurde ich noch einmal kontaktiert und gefragt, ob ich nicht daran teilnehmen wollte.
WiF: Welche Erfahrungen hast Du bei der Zusammenarbeit gemacht?
Mira: Während der Zusammenarbeit mit Vogelsang rückten für mich vor allem zwei Ansprechpersonen in den Vordergrund, zum einen Heike Pütz, die Leiterin des Kreisarchivs. Mit ihr stand die Erarbeitung der Texte und das Zusammentragen des Materials im Vordergrund. Es war eine mühsame Materialschlacht für mich persönlich. Als ich dann die fertige Ausstellung sah, wurde mir erst bewusst, welche Arbeit Heike Pütz geleistet hatte. Sie musste sich durch eine große Anzahl an Unterlagen, Scans und Fotos kämpfen. Trotzdem hat sie mich in meinen Themen immer gut betreut und gelegentlich auch sanften Druck ausgeübt, wenn es nötig war.
Meine Mitarbeit begann erst 2022, obwohl ich schon kurz vor Ausbruch der Pandemie eine erste Anfrage erhalten hatte. In der Zwischenzeit hatte die Eifelregion auch noch mit anderen verheerenden Themen zu kämpfen.
Mein zweiter Ansprechpartner war Stefan Wunsch, der als wissenschaftlicher Referent im NS-Dokumentationszentrum in Vogelsang tätig ist. Mit ihm habe ich ebenfalls viel am Inhalt gefeilt und Ideen entwickelt. Mit seinem historischen Fachwissen und Feingefühl für sensible Themen haben wir einen Vortragsabend erarbeitet. Die Zusammenarbeit mit ihm war auch sehr angenehm.
WiF: Welchen Eindruck hattest Du nach Deinem Vortrag in Vogelsang?

(Mira beim Vortrag in Vogelsang, © Vogelsang IP-Michael Pfeiffer)
Mira: Ich fühlte vor allem eine enorme Erleichterung und Freude, da ich normalerweise nicht gerne vor großen Menschenmengen spreche. Als ich den Vortrag in Vogelsang begann (jetzt muss ich schmunzeln) bemerkte ich flapsig zum Publikum, dass ich „geschockt“ sei, dass so viele Besucher gekommen waren. Das lag wohl an meiner Nervosität, aber ich denke, dass es mir am kommenden Sonntag nicht mehr passieren wird. Im Gegenteil, ich werde mich freuen, wenn einige Freilinger ins Bürgerhaus kommen, da es eine schöne Idee und Initiative von Markus Ramers war, einen Teil der Geschichte über Zwangsarbeit an den Ort zu bringen, wo sich die Ereignisse vor 80 Jahren abgespielt haben.
WiF: Wie bzw. in welcher Form hast Du Deine eigene Familiengeschichte für die Ausstellung und auch allgemein aufgearbeitet?
Mira: Meine eigene Familiengeschichte habe ich bisher verschriftlicht, aber da ich auch gerne mit alten Fotos arbeite, sie restauriere und retouschiere, kommen noch so einige Familienfotobücher zusammen, denke ich. Mein Medium ist mehr die Fotografie, mehr noch als Illustration, und seit dem Aufkommen der Umsetzung mit KI-basierten Programmen, kann man sich glaube ich noch ganz schön austoben.
WiF: Hast Du das Gefühl, dass dieses Thema in Deutschland genug wahrgenommen und aufgearbeitet wird? Wie wichtig ist es für dich, dass dieser Teil der Geschichte nicht vergessen wird?
Mira: Aus meiner Sicht wurde das Thema der Zwangsarbeit in Deutschland in den letzten Jahren definitiv mehr wahrgenommen, ob genug vermag ich allerdings nicht zu beurteilen, da mir der Überblick fehlt. Persönlich habe ich mich stärker mit dem Thema aus einer familiären Perspektive auseinandergesetzt, was mir ein tieferes Bedürfnis war. Dabei ist mir bewusst, dass die beiden Liebesgeschichten meiner Großmutter und ihrer Schwester, die trotz der schwierigen Umstände ein glückliches Ende fanden, eher Ausnahmen in einer Zeit waren, die von einem menschenverachtenden Regime wie den Nazis geprägt war und für so viele Menschen unerbittlich und tödlich endete.
WiF: Liebe Mira, ganz herzlichen Dank für das umfangreiche und sehr interessante Gespräch!
Mira: Sehr gerne!